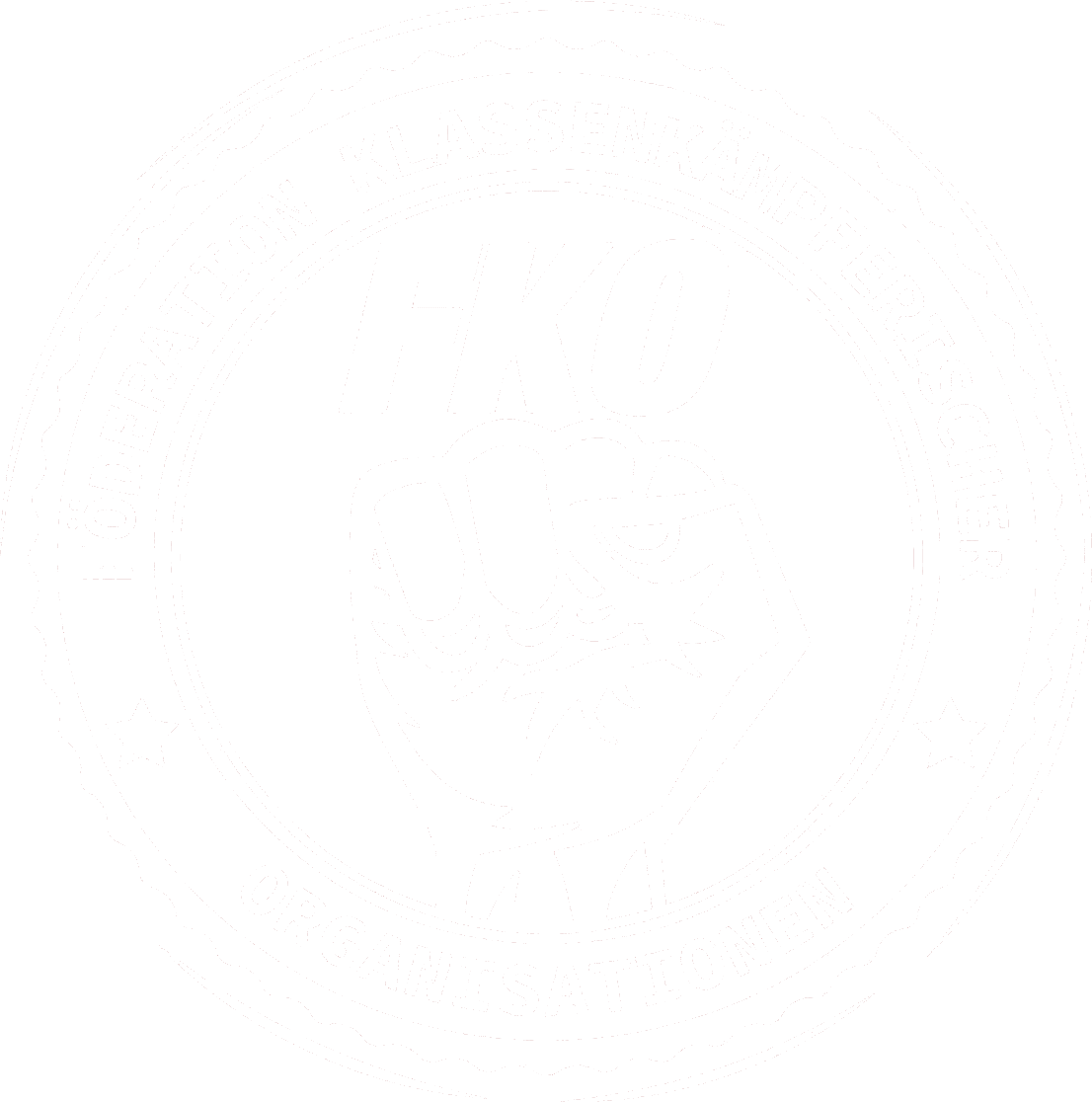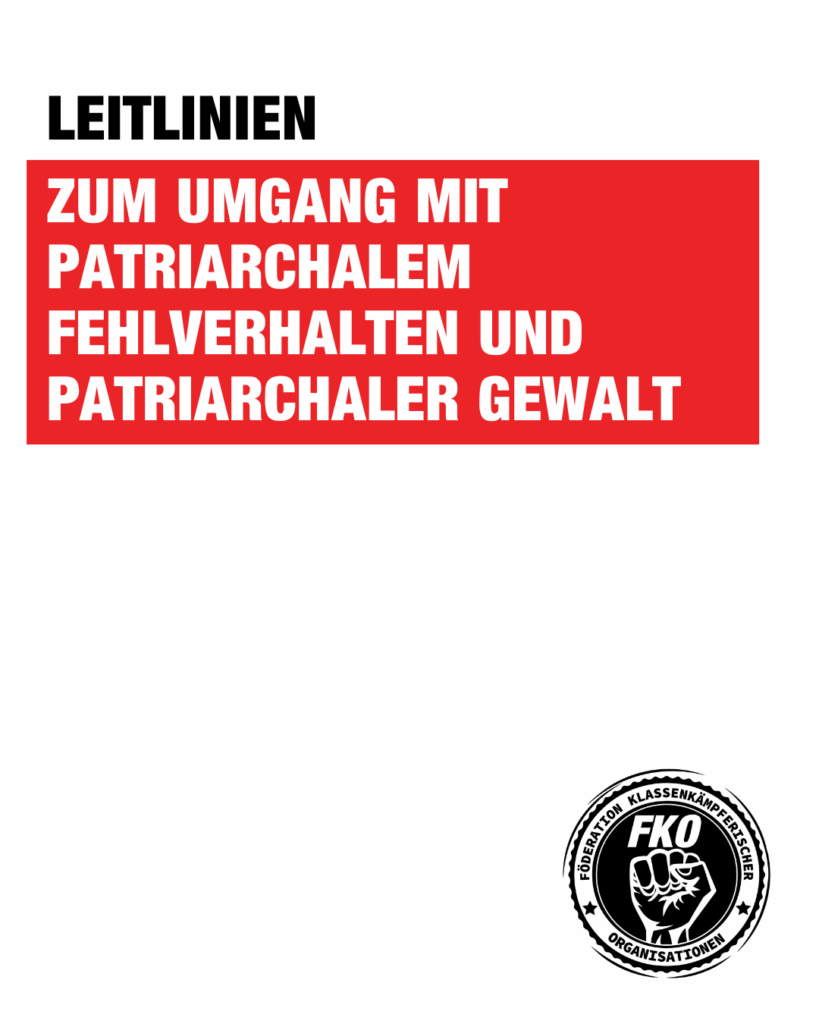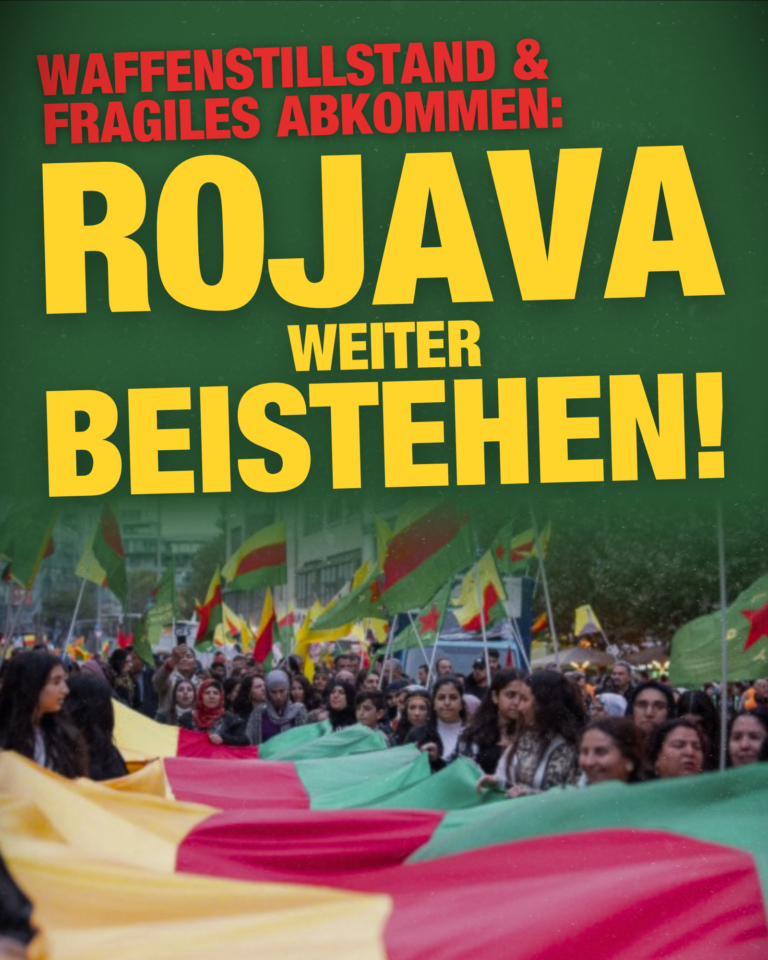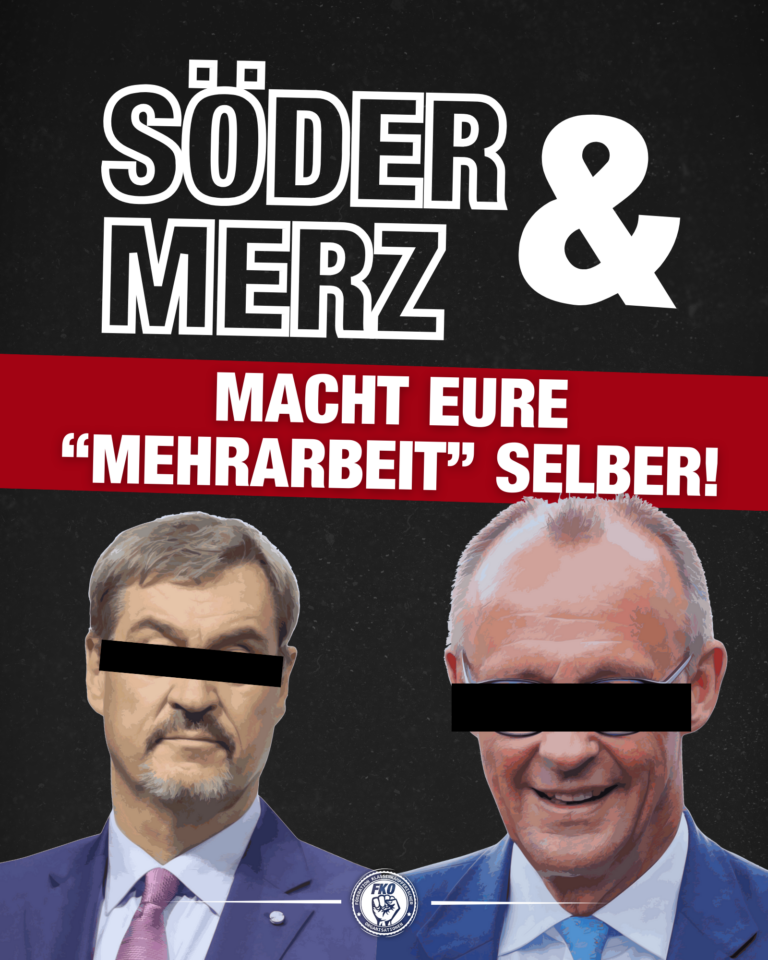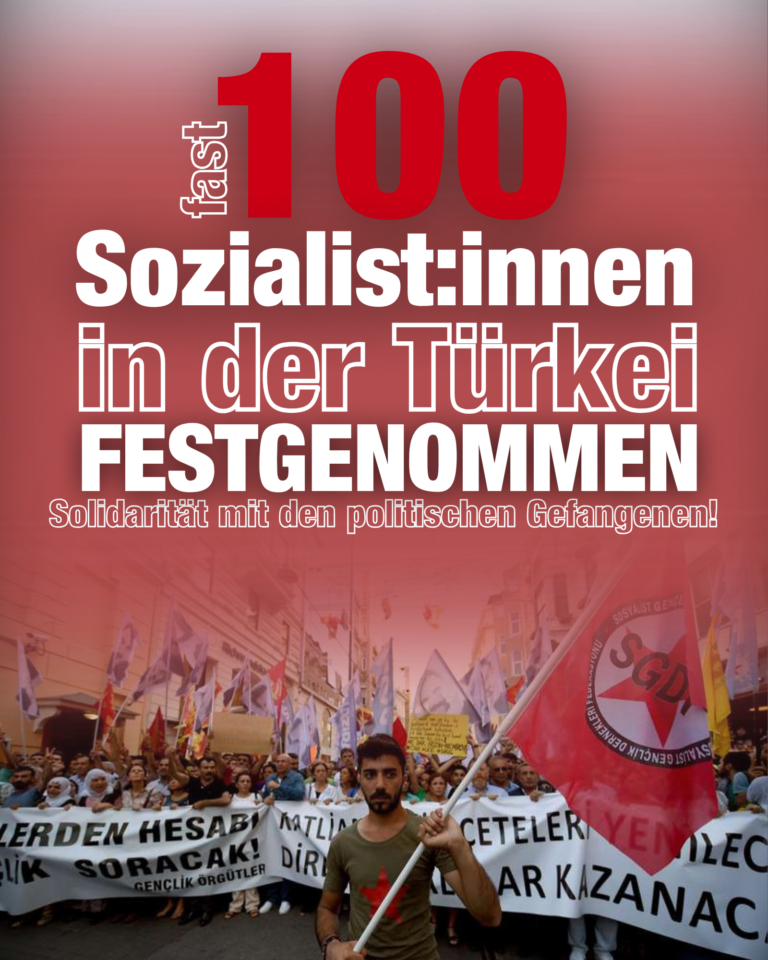Vorwort
Liebe Leser:innen,
in diesen Leitlinien legen wir als Föderation klassenkämpferischer Organisationen unseren Umgang mit patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt fest. Dafür müssen wir zunächst klären, was wir unter patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt verstehen, wie wir sie gesellschaftlich einordnen und was das für unseren gemeinsamen Kampf dagegen bedeutet. Im weiteren Verlauf widmen wir uns unserem Verständnis von Betroffenen- , Beschuldigten- und Täterarbeit. Aufbauend auf diesen ideologischen Grundlagen werden wir unsere grundlegenden Prinzipien im Umgang mit patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt darlegen, also Leitsätze, die sich aus unserem Verständnis vom Patriarchat ergeben und selbst wiederum die Grundlage für unseren konkreten Umgang bilden. Dieser Text legt also die Grundlagen unserer Arbeitsweise dar und wird durch interne Richtlinien ergänzt. Unseren konkreten Umgang werden wir an dieser Stelle also lediglich nachzeichnen.
Insgesamt stehen wir mit unseren Ausarbeitungen zu patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt erst noch am Anfang. Wir hoffen dennoch, dass wir mit der Veröffentlichung unserer Leitlinien einen Beitrag dazu leisten können, dass in unserer und in anderen Organisationen ein konsequenter Kampf gegen das Patriarchat geführt wird.
Grundlagen zu patriarchalem Verhalten, Fehlverhalten und Gewalt
Patriarchales Fehlverhalten und patriarchale Gewalt begegnet uns tagtäglich, egal ob in Form von Anschreien, Manipulation oder einem Klatsch auf den Po. Schubsen, Schlagen, Stalking – jede Frau kennt das und läuft dabei selbst Gefahr davon betroffen zu sein.
Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sind mehr als 40 Prozent der Frauen in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen.1 Es ist aber davon auszugehen, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist.
Zu der Betroffenheit von trans Personen gibt es in Deutschland leider noch keine repräsentativen Studien. Zahlen aus anderen Ländern zeigen aber, dass auch trans Personen in hohem Grad von patriarchaler Gewalt betroffen sind. So stellt eine britische Studie fest, dass eine von sechs trans Personen über körperliche und eine von zehn sexualisierte Gewalt im vergangenen Jahr erfahren
mussten. In einer US-amerikanischen Umfrage von 2015 berichteten 54 % der Befragten über irgendeine Form partnerschaftlicher Gewalt.2,3,4
Wenn also mindestens jede dritte Frau ist in ihrem Leben von Gewalt betroffen ist – und ebenfalls viele trans Personen -, dann muss es dementsprechend viele Täter geben, die diese Gewalt ausüben.
Der Großteil der Täter bei patriarchaler Gewalt sind Männer. Zudem findet die Gewalt nicht, wie so oft behauptet, vor allem im „dunklen Park“ statt oder wird durch Fremde ausgeübt. In den meisten Fällen passiert patriarchale Gewalt im sozialen Nahraum: die Täter sind unsere Väter, Freunde, Beziehungspersonen – und eben auch unsere Genossen. Denn das Patriarchat macht nicht vor politischen Räumen halt. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass patriarchale Gewalt auch in den eigenen Reihen vorkommt und wir diese auch hier konsequent bekämpfen müssen.
Aufbauend auf dieser Analyse gendern wir in dieser Broschüre den Beschuldigten- und Täterbegriff männlich und den Betroffenenbegriff alle Geschlechter einbeziehend. Denn unsere Sprache soll die Realität möglichst konkret wiedergeben und im Patriarchat werden eben nicht alle Geschlechter gleichermaßen Täter, sondern vor allem Männer. Ein großer Teil der Betroffenen sind hingegen Frauen sowie trans- und nicht-binäre Personen. Das beschriebene Vorgehen bleibt bestehen unabhängig des Geschlechts von Betroffenen oder Täter:innen.
Was ist patriarchales Verhalten, Fehlverhalten und Gewalt?
Wir alle wachsen im Kapitalismus auf. Das bringt mit sich, dass wir in patriarchale und bürgerliche Rollenbilder hinein erzogen werden. Diese prägen unsere Persönlichkeit und damit am Ende auch, wie wir uns fühlen und wie wir handeln. Das ist einer der Gründe, warum bürgerliches und patriarchales Verhalten in dieser Gesellschaft allgegenwärtig ist.
Dass patriarchales und auch bürgerliches Verhalten allgegenwärtig sind, bedeutet nicht, dass man nicht daran arbeiten braucht. Im Gegenteil: dadurch, dass es so tief in uns verankert ist, braucht es eine bewusste Arbeit daran – sowohl an der eigenen Persönlichkeit als auch im Kollektiv. Diese Arbeit am Verhalten muss daher auch in unserem Alltag stattfinden. Wir müssen lernen, einander zu kritisieren und falsches Verhalten aufzuzeigen. Auch unsere Art zu denken, wie wir uns fühlen und verhalten, muss in den Kontext einer patriarchalen Gesellschaft eingeordnet werden, um zu verstehen, wie diese uns und die Menschen um uns beeinflusst. Wir müssen die Verantwortung für unsere eigene Entwicklung und die von anderen übernehmen.
Das bedeutet nicht, dass wir organisierte Arbeit erst dann machen, wenn es sich um patriarchale Gewalt handelt. Patriarchales Handeln bewegt sich letzten Endes auf einem Spektrum, das bei patriarchalem Verhalten beginnt und bei patriarchaler Gewalt und letztlich dem Femizid als höchste Form der Gewalt endet. Einen großen Teil dieses Spektrums fassen wir unter den Begriff des patriarchalen Fehlverhaltens. Die Grenzen sind fließend. Patriarchales Fehlverhalten umfasst
eine Vielzahl an Handlungen, die man in ihrem konkreten Kontext bewerten muss. Hier fallen dementsprechend die Konsequenzen unterschiedlich aus.
Patriarchale Gewalt hat viele Facetten. Manche Formen sind offensichtlich zu erkennen und hinterlassen körperliche Spuren, manche sind versteckter und nicht so einfach nachzuweisen. Wir müssen es uns zur Aufgabe machen, patriarchale Gewalt in all ihren Formen entschlossen zu bekämpfen. Wir unterscheiden bei patriarchaler Gewalt zwischen psychischer, körperlicher und sexualisierter Gewalt.
Psychische Gewalt wird oft übersehen und noch öfter nicht ernst genommen. Denn hierbei gibt es keine körperlichen Spuren, wie blaue Flecken, um die Tat nachzuweisen. Dennoch existiert diese Gewalt und wird ausgeübt.
Körperliche Gewalt wird oftmals deutlicher wahrgenommen als psychische Gewalt – aber das auch nur, wenn körperliche Spuren vorhanden sind. Dies ist nämlich bei körperlicher Gewalt nicht zwangsläufig so.
Sexualisierte Gewalt bezeichnet die Gewalt, die im Kontext von sexuellen Handlungen ausgeübt wird. Da hier aber nicht die Sexualität, sondern die Machtausübung im Vordergrund der Gewalt steht, wird hierbei die Formulierung sexualisierte Gewalt verwendet. Der Grund für sexualisierte Gewalt liegt nämlich nicht, wie oft behauptet, im Sexualtrieb von Männern, sondern in durch das Patriarchat anerzogenen Rollenbildern und der damit verbundenen Machtposition innerhalb dieses Systems.
Die höchste Form der Gewalt an Frauen ist ein Femizid. Femizid, das bezeichnet den Mord an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. In Deutschland greift ein Mann alle 4,5 Minuten eine Frau an (meist (Ex-)Partnerin oder Familienangehörige), oder verletzt sie.5 Im Jahr 2024 wurden mindestens 360 Femizide in Deutschland begangen.6 Angesichts dieser Zahlen kann man nicht, wie es in der bürgerlichen Presse nur zu oft dargestellt wird, von einem „Einzelfall“, einem
„Familiendrama“ oder einer „Beziehungstat“ sprechen. Frauenmorde, also Femizide und Gewalt an Frauen, sind ein allgegenwärtiges Thema.
Was verstehen wir unter Betroffenen, Beschuldigten und Tätern?
Bei Betroffenen sprechen wir von Personen, die patriarchales Fehlverhalten oder Gewalt erlebt haben. Bei der Arbeit mit Menschen, denen gegenüber Vorwürfe vorliegen, sprechen wir von Beschuldigten und Tätern. Den Begriff Beschuldigter verwenden wir dann, wenn noch keine klare Einschätzung von Vorwürfen vorliegt, und dann, wenn es zu der Einschätzung kommt, dass es sich um patriarchales Fehlverhalten handelt. In denselben Fällen sprechen wir von Vorwürfen. In Fällen von patriarchaler Gewalt sprechen wir von Taten und dementsprechend von den ausübenden Personen als Täter.
Die Formen, in denen sich das Patriarchat im Verhalten und Handeln von Menschen zeigt, sind vielfältig. Unser Umgang muss dieser Realität gerecht werden. Er kann also ebenfalls das gesamte Spektrum von einer direkten Kritik, mehreren organisierten Gesprächen bis hin zu einem Prozess annehmen. Das hängt damit zusammen wie schwerwiegend das Verhalten ist und wie tief es in der Persönlichkeit wurzelt. Von Prozessen sprechen wir dann, wenn wir mit jemandem über einen längeren Zeitraum gezielt an seiner Persönlichkeitsentwicklung arbeiten. Hier werden klare Ziele gesetzt was verändert werden soll, in welchem Zeitraum und mit welchen Methoden das erreicht werden kann. Kommt die Frauenkommission zu dem Schluss, dass ein Prozess notwendig ist, dann ist dieser für den Beschuldigten oder Täter verpflichtend. Kommen diese der Pflicht nicht nach, ist mit einem Ausschluss aus der Organisation zu rechnen.
Welche Rolle spielt patriarchale Gewalt in diesem System?
Wir leben aktuell im Kapitalismus und Patriarchat. Ein System, welches sich durch die Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen auszeichnet. Dieses System hat zur Aufrechterhaltung seiner selbst verschiedene integrative Methoden hervorgebracht, mit denen man in das System gepresst werden soll. Führen diese integrativen Methoden nicht dazu, dass man sich scheinbar freiwillig diesem System unterwirft, soll Gewalt als Methode schließlich zu dieser Unterwerfung führen. Gewalt an Frauen und trans Personen spielt deswegen in diesem System eine ganz besondere Rolle. Sie hat die Funktion, die Ausbeutung der Frau sowie die Vormachtstellung des Mannes aufrechtzuerhalten.
Wie bekämpfen wir patriarchales Fehlverhalten und Gewalt?
Unsere erste Antwort auf patriarchales Fehlverhalten und Gewalt an Frauen heißt Frauensolidarität! Frauensolidarität heißt einander zu glauben, sich zu unterstützen und füreinander einzustehen. Es bedeutet, bei Gewalt an Frauen und patriarchalem Fehlverhalten nicht wegzuschauen. Es bedeutet, uns nicht in scheinbare Konkurrentinnen spalten zu lassen, wie es uns oft weis gemacht wird, sondern uns als Frauen gemeinsam zu organisieren und uns zu verbünden. Frauensolidarität bedeutet aber ebenso, einander als Frauen zu kritisieren, bspw. bei falschem eigenem bürgerlichem Verhalten – um uns gemeinsam zu verbessern und zu stärkeren Kämpferinnen im Kampf gegen Patriarchat und Kapitalismus zu entwickeln.
Wenn wir patriarchale Gewalt bekämpfen wollen, dann muss patriarchales Verhalten überall dort, wo es uns begegnet, kritisiert werden. Wir müssen eine Bewusstseinsänderung bei uns und unserem Umfeld schaffen, egal ob auf der Arbeit, bei Kolleg:innen, in der Schule oder auch bei unseren Genoss:innen. Nur so können wir patriarchale Gewalt verhindern bevor sie auftritt.
Um den Kampf gegen patriarchales Verhalten, Fehlverhalten und patriarchale Gewalt in unseren eigenen Reihen konsequent führen zu können, braucht es Leitlinien, die in der Praxis angewendet werden, sowie entwickelte Strukturen, die diese Arbeit leisten und schnell reagieren. Darüber hinaus müssen wir stetig daran arbeiten Geschlechtsbewusstsein zu entwickeln, innerhalb unserer eigenen Strukturen, aber letztlich auch in der Klasse. Geschlechtsbewusstsein bezeichnet die Klarheit darüber, welche gesellschaftliche Rolle dem eigenen Geschlecht im Kapitalismus und Patriarchat zugewiesen wird und welche Machtposition oder Unterdrückung damit einhergeht. Dazu gehört auch ein Bewusstsein darüber, was nötig ist, um das Patriarchat als Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnis zu bekämpfen und selbst bereit zu sein, in diesem Kampf eine aktive Rolle einzunehmen.
Der konsequente Kampf gegen patriarchales Verhalten, Fehlverhalten und Gewalt bedeutet, dass wir als Klasse gegen dieses System ankämpfen, welches von der Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen profitiert – und das in Form der Frauenrevolution. Die Frauenrevolution ist eine Revolution, die für die Befreiung aller Geschlechter und konsequent gegen jegliche Form patriarchalen Verhaltens kämpft. Für eine erfolgreiche Frauenrevolution müssen wir die Grundpfeiler des Patriarchats bekämpfen, also auch den Kapitalismus. Was wir also brauchen, ist eine sozialistische Revolution, die ein System erkämpft, welches frei ist von Ausbeutung und Unterdrückung. Deshalb muss also die Frauenrevolution und die sozialistische Revolution miteinander einhergehen.
Kämpfen wir also gegen Kapitalismus und Patriarchat. Kämpfen wir für die Frauenrevolution und für den Sozialismus!
Unsere allgemeinen Prinzipien im Umgang mit patriarchaler Gewalt und patriarchalem Fehlverhalten
- Frauen leiten den Kampf gegen patriarchales Fehlverhalten und Gewalt an.
Um patriarchales Fehlverhalten und patriarchale Gewalt in den eigenen Reihen bekämpfen zu können, benötigen wir entwickelte Strukturen, die dazu arbeiten. Das liegt daran, dass wir alle im Patriarchat entsprechend unserer geschlechtlich zugeteilten Rolle sozialisiert sind. Männer nehmen im Patriarchat die Rolle des Unterdrückers ein, Frauen die Rolle der Unterdrückten. Diese Verhältnisse sind tief in der Gesellschaft und in unserer Persönlichkeit verankert und spiegeln sich in unseren Verhaltensweisen und Gedanken wider.
Männer profitieren von ihrer zugewiesenen Rolle in diesem System. Patriarchales Verhalten, Fehlverhalten und Gewalt erhalten diese Rolle und die darauf aufbauende Vormachtstellung aufrecht. Das bedeutet, dass Männer eben auch von ihrem eigenen patriarchalen Verhalten und dem anderer Männer einen Vorteil ziehen. Die Frauen der Arbeiter:innenklasse haben dagegen ein objektives Interesse, das Patriarchat mit all seinen Facetten zu bekämpfen.
Damit einher geht, dass es die proletarischen Frauen sein müssen, die diesen Kampf gezielt anführen und die Entscheidungen im Umgang mit patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt treffen. Dass Frauen diesen Kampf anführen, bedeutet nicht, dass andere Teile des Kollektivs von ihrer Verantwortung im Kampf gegen das Patriarchat entbunden sind, im Gegenteil, es ist die Verantwortung des gesamten politischen Kollektivs, den Kampf gegen das Patriarchat zu führen.
Dass die Arbeit zu patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt von Frauen angeleitet wird, bedeutet nicht, dass nur diese dazu arbeiten. Generell können unter der Anleitung der Frauen alle Geschlechter in die Arbeit eingebunden werden.
Konkret ergibt sich aus dieser Haltung, dass auch innerhalb der FKO die Frauen diese Kämpfe anleiten.
- Wir stehen parteiisch auf der Seite der Betroffenen.
Aber was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass wir den Betroffenen glauben, wenn sie einen Vorwurf vorbringen. Der Beschuldigte hat das Recht, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Stimmt er dem Vorwurf nicht zu, dann muss er entgegen dem bürgerlichen Justizsystem glaubhaft darlegen, dass er die Tat nicht begangen hat.
Warum handeln wir so?
Patriarchale Gewalt oder Fehlverhalten hinterlassen in vielen Fällen keine sichtbaren Spuren und sind noch viel schwerer zu beweisen. Wenn wir von Betroffenen fordern würden, diese zu beweisen, dann würde das dazu führen, dass viele Gewalttaten und Fehlverhalten nicht nachgewiesen werden können und nicht dazu gearbeitet werden kann. Zudem wissen wir, dass aufgrund der patriarchalen Sozialisation im kapitalistisch-patriarchalen System häufig den Betroffenen nicht geglaubt oder sie für ihre Erfahrungen verantwortlich gemacht werden. Immer wieder fallen die Urteile bei der bürgerlichen Justiz, oder auch der Umgang in der politischen Widerstandsbewegung, zulasten von Betroffenen aus. Indem wir die Grundregel festlegen, dass wir der betroffenen Person glauben und die beschuldigte Person glaubhaft darlegen muss, dass sie die vorgeworfene Tat nicht begangen hat, drehen wir den Spieß um. Wir stellen uns entgegen dem bürgerlichen Justizsystem auf die Seite Betroffener.
- Wir legen einen besonderen Fokus auf die Arbeit mit Betroffenen.
Bei der Arbeit zu patriarchalem Fehlverhalten oder patriarchaler Gewalt muss ein besonderer Fokus auf die Arbeit mit Betroffenen gelegt werden. Klar ist, dass die Betroffenenarbeit und die Arbeit mit der beschuldigten Person nicht gegeneinander diskutiert werden sollten. Beides hat seine Wichtigkeit und beides dient der effektiven Bekämpfung des Patriarchats. Bei der Betroffenenarbeit geht es darum, die Betroffenen zu unterstützen, die Tat mit ihnen zusammen politisch aufzuarbeiten, sie in den Prozess zum Vorwurf oder zur Tat mit einzubeziehen, wenn sie das möchten und einen Rückzug zu verhindern, denn patriarchales Fehlverhalten und Gewalt bringen Betroffene häufig in eine Lage in der ihnen eine politische Aktivität unmöglich scheint. Bei der Arbeit mit der beschuldigten Person geht es darum, das Geschlechtsbewusstsein zu heben, sodass die vorgeworfene Tat aufgearbeitet wird und sich das Verhalten verbessert. In Fällen in dem die Arbeit mit einem Beschuldigten oder Täter der Arbeit mit einer betroffenen Person im Weg steht, gilt es die Arbeit mit der betroffenen Person zu priorisieren.
- Wir nehmen patriarchales Fehlverhalten und patriarchale Gewalt ernst und handeln auch so.
Dass wir patriarchales Fehlverhalten und patriarchale Gewalt ernst nehmen, muss sich in ein konsequentes Handeln übersetzen. Darauf beziehen sich alle unsere Prinzipien. Unter diesem Punkt wollen wir noch mal im engeren Sinne darauf eingehen, dass wir schnell und konsequent handeln, sowie einen bewussten Umgang mit sensiblen Informationen pflegen.
Das bedeutet: Sobald wir von Vorwürfen erfahren, gehen wir ihnen nach! Dabei ist es egal, von wem wir die Vorwürfe erfahren, wie schwerwiegend der Tatvorwurf ist, oder wie lange die vorgeworfene Tat zurückliegt. Wir nehmen alle Vorwürfe ernst und danach müssen wir dementsprechend handeln.
Wir stützen uns dabei nicht auf Gerüchte, die wir hören. Bekommen wir von Gerüchten mit, die sich um patriarchales Fehlverhalten und Gewalt drehen, dann fragen wir nach, mögen diese noch so unkonkret oder vage sein. Wir mutmaßen nicht über Informationen und Details, die uns fehlen. Vorwürfen nachgehen bedeutet möglichst Kontakt zur betroffenen Person und von ihr möglichst genaue Informationen aus erster Hand zu erhalten. Darüber hinaus sollte auch versucht werden, eine Aussage vom Beschuldigten einzuholen.
Das bedeutet gleichzeitig, dass alle Personen, die Teil unserer Strukturen sind, die Pflicht haben, alle Vorwürfe, von denen sie mitbekommen, weiterzuleiten. Die Vorwürfe werden dabei zunächst an die Ansprechperson der Frauenkommission aus der eigenen Stadt oder Region weitergeleitet. Hierbei wird stets darauf geachtet sich mit den Betroffenen, wo möglich, darüber zu sprechen welche Informationen weitergeleitet werden und nur die Informationen weiterzugeben, die notwendig sind für die Arbeit. Die Verantwortung Vorwürfe von denen einem berichtet wird weiterzuleiten liegt dabei nicht nur bei der für die Arbeit zuständigen Kontaktperson der Frauenkommission, sondern bei dem gesamten lokalen Kollektiv.
In der politischen Arbeit kommen wir immer wieder mit mehr oder weniger schwerwiegendem patriarchalen Fehlverhalten und Gewalt in Kontakt. Dass wir Vorwürfe weiterleiten und die verantwortlichen Genossinnen diesen nachgehen, darf nicht bedeuten, dass lokal der Anspruch, anti-patriarchale Arbeit zu machen, zurückgeht. Es ist die Aufgabe von jeder und jedem von uns, unsere Genoss:innen zu kritisieren und bei akutem Verhalten einzugreifen.
- Wir sind in der Analyse von Vorwürfen und Taten so objektiv wie möglich. Darauf aufbauend erfolgt eine politische Einordnung und Konsequenz.
Im Umgang mit patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt bildet die möglichst objektive Einschätzung eines Vorwurfs oder einer Tat, die Grundlage für die Konsequenzen und den Prozess mit Beschuldigten und Tätern. Diese muss immer um eine politische Einordnung ergänzt werden. Nur in dieser Kombination entsteht eine allseitige Bewertung. Darauf aufbauend wird politisch entschieden, welche Konsequenzen erfolgen. Denn obwohl die Konsequenzen auf den Vorwurf
oder die Tat an sich aufbauen, haben noch andere Faktoren einen Einfluss. Dazu zählt zum einen eine Einschätzung des Beschuldigten oder Täters, die auch zurückwirken kann auf die Einschätzung des Vorwurfs oder Tat, aber auch eine Einschätzung darüber, welche Maßnahmen notwendig sind, um eine Arbeit mit der betroffenen Person zu organisieren und welche Ressourcen der Organisation zur Verfügung stehen.
Die Objektivität in der Einschätzung bleibt an dieser Stelle begrenzt. Basierend auf der Aussage der betroffenen Person, ergänzend des Beschuldigten oder Täters und je nachdem auch anderer anwesender Personen wird versucht, ein möglichst genaues Bild der Situation zu zeichnen, in der das kritisierte Fehlverhalten oder die Gewalt aufgetreten ist, sowie der Handlung selbst. Hierbei muss klar sein, dass es in der Regel keine Möglichkeit gibt, eine Situation, in der patriarchales Fehlverhalten oder Gewalt aufgetreten ist, in allen Details nachzuzeichnen. Der Versuch, das zu tun, wäre kontraproduktiv und würde dazu führen, dass man sich, anstatt eine wesentliche Einschätzung zu machen, vor allem daran aufhängt zu versuchen Details zu klären, die aus der Erinnerung heraus nicht klärbar sind. Im schlimmsten Fall verhindert man dadurch eine Aufarbeitung eines Vorwurfs und bringt Betroffene in die Lage, doch wieder beweisen zu müssen, dass ihnen etwas passiert ist. Hier kommt auch die politische Einschätzung ins Spiel. Zu versuchen, eine Tat vermeintlich „neutral“ zu analysieren, führt vor allem dazu, bestehende Machtverhältnisse außer Acht zu lassen. Dementsprechend muss die Analyse einer Tat weitergehen. In ihr muss das patriarchale Unterdrückungsverhältnis und das konkrete Machtverhältnis zwischen Beschuldigten, Tätern und Betroffenen inbegriffen werden. Darüber hinaus spielt auch die politische Einschätzung des Beschuldigten oder Täters eine Rolle.
Unter Objektivität verstehen wir noch einen weiteren Aspekt als den erstgenannten. Objektivität bedeutet auch, dass Emotionen in der Bewertung der Tat keine Rolle spielen dürfen. Weder freundschaftliche Gefühle gegenüber der beschuldigten Person, noch bspw. persönliche Abneigungen gegenüber der betroffenen Person. Viel zu häufig bekommt man mit, wie Beschuldigte geschützt werden, weil andere Personen sich ein solches Verhalten bei der Person nicht vorstellen können. So etwas müssen wir klar unterbinden! Wenn wir sagen, dass die Emotionen bei der Bewertung der Tat außen vor gelassen werden sollten, bedeutet das nicht, dass es keinen Raum für Emotionen gibt, ganz im Gegenteil. Das Erfahren von patriarchalem Fehlverhalten oder Gewalt kann sehr schmerzhaft sein und hier den Emotionen Raum zu geben und die Betroffenen zu unterstützen, stellt insbesondere in der Betroffenenarbeit einen wichtigen Aspekt dar.
- Wir arbeiten stetig daran in unserer Organisation Geschlechtsbewusstsein aufzubauen und den Kampf gegen das Patriarchat voranzutreiben.
In unseren Organisationen arbeiten wir nicht nur reaktiv an patriarchalem Verhalten, Fehlverhalten und Gewalt. Der konsequente Kampf gegen das Patriarchat umfasst viel mehr. Wir tragen den anti- patriarchalen Standpunkt in alle Kämpfe auf der Straße und analysieren, wie die besondere
Situation von Frauen, trans und nicht-binären Personen sich hier zeigt. Wir treiben die Entwicklung des Geschlechtsbewusstseins mit verschiedenen Methoden voran.
- Wir verteidigen das Selbstverteidigungsrecht von Frauen, trans– und nicht-binären Personen.
Frauen, trans und nicht-binäre Personen sind besonders stark von patriarchaler Gewalt betroffen. Im Jahr 2024 gab es in Deutschland nach offiziellen Zählungen 360 Femizide. Die Anzahl der Straftaten im Bereich „Sexuelle Orientierung“ und „Geschlechtsbezogene Diversität“ hat sich seit 2010 nahezu verzehnfacht.7 Die Dunkelziffer in beiden Bereichen liegen vermutlich weit höher.
Selbstverteidigung gegen patriarchale Gewalt ist legitim, und wir sehen die Verteidigung dieses Rechts als essenziellen Teil unserer Arbeit an. Selbstverteidigung hat dabei viele Facetten und geht für uns über die unmittelbare Gegenwehr hinaus.
Wie arbeiten wir zu Vorwürfen von patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt?
Unter diesem Punkt wollen wir unsere grundlegende Arbeitsweise skizzieren, wenn wir von Vorwürfen von patriarchalem Fehlverhalten oder patriarchaler Gewalt erfahren. Die Systematisierung dieses Arbeitsbereichs ist notwendig, um systematischer und professioneller mit patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt umzugehen. Schemata haben allerdings definitionsgemäß enge Grenzen. In der Realität werden verschiedene Punkte dieses Ablaufes meist parallel zueinander staИinden. Deshalb werden wir an dieser Stelle bewusst keinen Ablaufplan veröffentlichen.
Was ist die Frauenkommission?
Die Frauenkommission ist zuständig für die Anleitung der Arbeit. Sie setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Frauen aus den FKO-Organisationen. Im ersten Schritt werden Vorwürfe in die Kommission gegeben, diese legt dann Gremien und Verantwortliche für die Arbeit fest, sodass die Arbeit und die Anleitung dieser gewährleistet werden können.
Personen, die mit der Frauenkomission in Kontakt treten möchten und denen keine direkte Ansprechperson bekannt ist, erreichen diese unter der folgenden E-mail-Adresse: frauenkommission@fkoonline.org.
Im Sinne des Datenschutzes empfehlen wir, die Adresse vor allem zur Vereinbarung von Terminen zu nutzen und nicht dazu konkrete Informationen über Vorwürfe weiterzugeben. Die E-Mail Adresse kann über die Äußerung von Vorwürfen auch genutzt werden, um im Allgemeinen mit der Kommission in Kontakt zu treten. Hier kann es Sinn ergeben euer Anliegen konkreter zu formulieren.
Wie handeln wir, wenn wir von Vorwürfen erfahren?
Nach dem Erfahren von Vorwürfen muss unmittelbar ein Gespräch mit der betroffenen Person gesucht werden, um eine Grundlage zu haben, auf der der Vorwurf eingeordnet werden kann. Ab diesem Zeitpunkt beginnt auch die Betroffenenarbeit, insofern dies von der betroffenen Person gewünscht ist.
Beim Bekanntwerden von Vorwürfen können beschuldigte Personen für einen festgelegten Zeitraum aus der politischen Arbeit herausgenommen werden. Diese Zeit hat nicht denselben Zweck wie ein Ausschluss, sondern dient als Zeitraum, in dem eine erste Arbeit mit den Betroffenen organisiert werden kann, in der eine Einschätzung des Vorwurfs gemacht und Konsequenzen festgelegt werden.
Dieser Zeitraum sorgt ebenfalls dafür, dass allen beteiligten Personen hierdurch ein zeitlicher Rahmen gesetzt wird, der auch dafür sorgt, dass Arbeit in dem Zeitraum erledigt wird. Dieses Verfahren sollte das grundsätzliche Vorgehen beim Erfahren von Vorwürfen sein.
Wenn wir Informationen zu den Vorwürfen erhalten haben, geht es darum, die Tat politisch einzuordnen, eine Einschätzung zu der möglichen Arbeit, zu der beschuldigten Person und zu den möglichen Konsequenzen zu treffen.
Wir wollen hier an dieser Stelle nicht konkrete Konsequenzen in Bezug auf bestimmte Taten benennen. Denn jeder Fall ist anders, jeder Fall muss individuell betrachtet werden und Fallbeispiele würden hierbei nur dazu führen, dass diese dogmatisch angewandt werden.
Stattdessen müssen wir uns vor Augen halten, dass es eine Spanne an Konsequenzen gibt, die wir anwenden können und müssen. So kann bspw. eine Arbeit zur Hebung des Geschlechtsbewusstseins eine richtige Konsequenz sein in Bezug auf patriarchales Fehlverhalten. Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie die Enthebung aus Gremien und Aufgaben der politischen Arbeit. Oder letztlich ein endgültiger Ausschluss aus der politischen Arbeit. Ebenso wie ein darüber hinaus gehendes Kontaktverbot.
Die Möglichkeiten sind vielfältig und es gibt sicherlich darüber hinaus noch weitere Konsequenzen, die in bestimmten Situationen als notwendig erachtet werden. Nichtsdestoweniger müssen wir uns vor Augen halten, dass im kapitalistisch-patriarchalen System unsere Mittel begrenzt sind.
Einen kollektiven Umgang mit den Vorwürfen organisieren
Wenn Vorwürfe bekannt werden, dann muss das politische Kollektiv in einem festgelegten Rahmen darüber informiert werden. Der Detailgrad, in dem in verschiedenen Gremien und Ebenen einer Organisation über Vorfälle von patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt gesprochen wird, kann und muss sich unterscheiden. Es wird vor allem das kommuniziert, was für die Arbeit mit Betroffenen, Beschuldigten oder Tätern notwendig ist.
Das Teilen von erlebtem patriarchalem Fehlverhalten oder Gewalt erfordert viel Vertrauen und bedeute zugleich, dass Betroffene sehr persönliche und intime Informationen mit uns teilen.
Deshalb ist es an dieser Stelle von höchster Bedeutung, dass mit Betroffenen intensiv darüber
kommuniziert wird, welche Details an welche Stelle weitergegeben werden und hierüber eine möglichst große Einigkeit besteht.
Auf die verantwortungsbewusste und zielgerichtete Weitergabe von Informationen muss unbedingt geachtet werden. In Fällen, in denen wahllos Informationen nach Außen oder an unbeteiligte Personen weitergegeben werden, kann ein großer Schaden für die Betroffenen entstehen, da es hierbei immer wieder zu Eigendynamiken kommt, die in der Regel stark durch die patriarchale Sozialisation geprägt sind. Die breite Diskussion über intime Details kann dabei äußerst belastend für Betroffene sein und einer Aufarbeitung des erlebten Verhaltens oder der Gewalterfahrung im Weg stehen. Auch für die Arbeit mit Beschuldigten und Tätern ist es negativ, wenn durch „stille Post“ Missverständnisse entstehen oder gegenüber einer produktiven Diskussion vor allem „Lästerei“ in den Vordergrund rückt.
Wie arbeiten wir mit den Betroffenen?
Gemeinsame Einordnung des Vorwurfs
In der Arbeit zu patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt können die ersten Reaktionen entscheidend sein. Hier müssen wir Betroffenen klar zeigen, dass wir ihnen glauben und gemeinsam handeln wollen. Eine Aufgabe in der Betroffenenarbeit ist es, die Tat in den Kontext der gesellschaftlichen Realität zu setzen. Es ist wichtig, Betroffenen zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind mit dem, was ihnen passiert ist, dass sie keine Schuld tragen. Im Zusammenhang damit ist es außerdem wichtig, dass wir unsere Einschätzung des Vorwurfs oder der Tat mit Ihnen teilen.
Gemeinsamer Umgang mit Emotionen von Betroffenen und Unterstützung bei der Suche nach Hilfe
Patriarchales Fehlverhalten und patriarchale Gewalt stellen für Betroffene in der Regel auch eine psychische Belastung dar, die Schwere variiert hier je nach Tat, Vorerfahrung und Persönlichkeit der Betroffenen. In der Arbeit mit Betroffenen muss es daher eine feste Ansprechperson geben, mit der die betroffene Person über die Gefühle in Bezug auf den Vorwurf und die Tat sprechen kann.
Früher oder später kann es notwendig sein, dass therapeutische Hilfe dazu geholt wird. Auch hierbei werden wir unterstützen. Denn antipatriarchale Arbeit zu machen zu patriarchalem Fehlverhalten oder Gewalt ersetzt in keiner Weise die professionelle Arbeit einer Therapeut:in. Diese Form der Unterstützung können wir gar nicht leisten, weswegen wir auch hier an der Seite der Betroffenen stehen und sie auch unterstützen müssen. Dasselbe kann auch sein, wenn andere Hilfe in Form von Beratungsstellen oder Schutz in Frauenhäusern benötigt wird. Die Inanspruchnahme von externen Angeboten spricht das Kollektiv allerdings nicht davon frei, sie politisch zu begleiten.
Festlegen von einem Rahmen und Maßnahmen, die Betroffenen politische Aktivität ermöglichen
Ein Ziel in der Betroffenenarbeit ist, den Rahmen zu schaffen, damit sie weiterhin politisch aktiv sein können.
Die Arbeit mit Beschuldigten und Tätern ist nicht nur eine Belastung für Betroffene, sondern ebenso ein Mittel, sich gegen das Patriarchat zu wehren. Im Kapitalismus geht das Erleben von patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt häufig mit einem Gefühl der Ohnmacht einher. Die konkrete Arbeit zum eigenen Fall kann dabei helfen, das zu überwinden. Hier spüren Betroffene, dass sie der Situation nicht schutzlos ausgeliefert sind, sondern selbst etwas bewirken können.
Das gilt auch für die antipatriarchale Arbeit im Allgemeinen. Hier erleben Frauen, dass die unterdrückerischen gesellschaftlichen Zustände nicht so bleiben müssen, wie sie sind, sondern dass sie die Macht haben, sie zu verändern.
Damit das auch tatsächlich realisiert werden kann, ist es nötig, mit Betroffenen darüber zu sprechen, welche Maßnahmen zu welchen Zeitpunkten getroffen werden müssen, um sie im Erhalt ihrer politischen Aktivität zu unterstützen. Zum Beispiel sicherzustellen, dass ein Abstand zwischen der betroffenen Person und dem Beschuldigten oder Täter kreiert wird, zum Beispiel durch einen Organisationswechsel.
Einbeziehung von Betroffenen in politische Prozesse
Ein Teil der Arbeit mit Betroffenen ist, sie in die politischen Prozesse, die wir mit dem Beschuldigten oder Täter führen, einzubeziehen. Hierzu gehört, Konsequenzen und Maßnahmen mit den Betroffenen zu diskutieren, ihre Meinung dazu einzuholen und zu versuchen, auf einen möglichst großen Konsens zu kommen. Natürlich kann es auch in dieser Arbeit zu Widersprüchen kommen, unter anderem dann, wenn sich herausstellt, dass man eine unterschiedliche Haltung zu antipatriarchaler Arbeit hat. Hier ist unser Ziel, politisch mit Betroffenen zu diskutieren.
Grundsätzlich haben wir den Anspruch, Betroffene in die Arbeit einzubeziehen – ist das von ihnen nicht gewünscht, akzeptieren wir das. Der Erhalt von Informationen wird Betroffenen nachträglich möglich gemacht, falls sie sich umentscheiden.
Wie gehen wir damit um, wenn betroffene oder beschuldigte Personen nicht Teil der FKO sind?
Wir haben den Anspruch auch Fällen nachzugehen, wenn bspw. die betroffene oder die beschuldigte Person nicht Teil unserer Organisation ist. Wir nehmen Vorwürfe ernst, unabhängig davon, wer sie äußert.
Es ist unsere Verantwortung, in der Betroffenenarbeit Kontakt zu den Betroffenen zu organisieren. Ist die betroffene Person Teil einer anderen Struktur, dann geschieht das in Absprache mit dieser.
Werden Vorwürfe geäußert, die sich gegen Beschuldigte oder Täter richten, die Teil einer anderen Organisation sind, dann informieren wir diese und haben den Anspruch, dass hiermit ein entsprechender Umgang gefunden wird. Reorganisieren sich Täter in anderen Organisationen, die wir aus unseren Strukturen ausgeschlossen haben, dann informieren wir diese.
Wie machen wir präventive Arbeit?
Der Kampf gegen patriarchales Fehlverhalten und Gewalt ist notwendig, er muss jedoch weit mehr umfassen als nur den Aufbau von Strukturen, die reaktiv zu Vorfällen, mit Betroffenen, Beschuldigten und Tätern arbeiten. Diese Broschüre hat vor allem die Aufgabe, Leitlinien zu Letzterem zu formulieren. An dieser Stelle wollen wir jedoch noch ein Mal den Blick öffnen für den einen anderen Aspekt der antipatriarchalen Arbeit, der damit eng verbunden ist: präventive Arbeit.
Die Prävention von patriarchalem Fehlverhalten und Gewalt findet im weiteren Sinne über die antipatriarchale Arbeit statt, die durch die gesamte Organisation gemacht wird und das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, das hierdurch geschaffen wird. Also darüber, dass Geschlechtsbewusstsein in der gemeinsamen politischen Arbeit geschaffen wird. Sie wird über die praktische Arbeit in Form von Aktionen wie zum Beispiel zum 25. November oder Femiziden, über die Einbeziehung des Blickwinkels der Frauen in alle unsere Arbeitsbereiche – die ein Bewusstsein über das Patriarchat bei allen Geschlechtern fassen, geleistet. Aber auch über die Rolle der Frauen in der politischen Arbeit, in den Plena, in der Bildung, auf der Straße und in den Organisationsgeflechten spielen, die ein ausgeglicheneres Verhältnis zwischen den Geschlechtern schaffen. Die Schaffung einer antipatriarchalen Kultur ist unserer Meinung eine der Hauptfragen in der Frage der Prävention. Der Aufbau von Geschlechtsbewusstsein in unseren Strukturen kann dabei nicht anhand einer To-do-Liste erfolgen, die wir abhaken können.
In einer patriarchalen Gesellschaft werden wir Fehlverhalten und Gewalt niemals völlig verhindern können, denn ein System, das auf Ausbeutung und Unterdrückung angewiesen ist, muss diese auch mit verschiedenen Mitteln aufrechterhalten. Deshalb bleibt es wie oben beschrieben unser erklärtes Ziel, für eine freie Gesellschaft im Sozialismus und den Sieg über das Patriarchat zu kämpfen. Mit dieser Einordnung verliert präventive Arbeit keinesfalls ihre Relevanz, im Gegenteil gerade diese Erkenntnis verpflichtet uns. Denn auch wenn wir Fehlverhalten und Gewalt nicht völlig verhindern können, müssen wir die Reproduktion davon in unseren eigenen Reihen und letztlich auch der Klasse so weit zurückdrängen, wie wir können.
In der direkten Präventionsarbeit muss das Ziel sein, aufzuklären, ein antipatriarchales Bewusstsein (weiter-) zu entwickeln und Wissen weiterzugeben. Hier stehen uns viele Möglichkeiten offen, über Vorträge, Seminare bis hin zu Wochenendschulungen oder ganze Camps.
- https://www.bmfsfj.de/resource/blob/84384/5ca54bf32901232f07ab4ff4132000b6/pressemat-studie-gewalt- frauen-lebenssituation-data.pdf ↩︎
- https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2024-lgbtiq-equality_en.pdf ↩︎
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7427218/ ↩︎
- https://www.psychiatryadvisor.com/news/intimate-partner-violence-transgender-people/ ↩︎
- https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/ Partnerschaftsgewalt/Partnerschaftsgewalt_2021.html?nn=63476 ↩︎
- https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/StraftatenGegenFrauen/StraftatengegenFrauenBLB2023.html?nn=237578 ↩︎
- https://www.lsvd.de/de/ct/2445-Queerfeindliche-Gewalt ↩︎